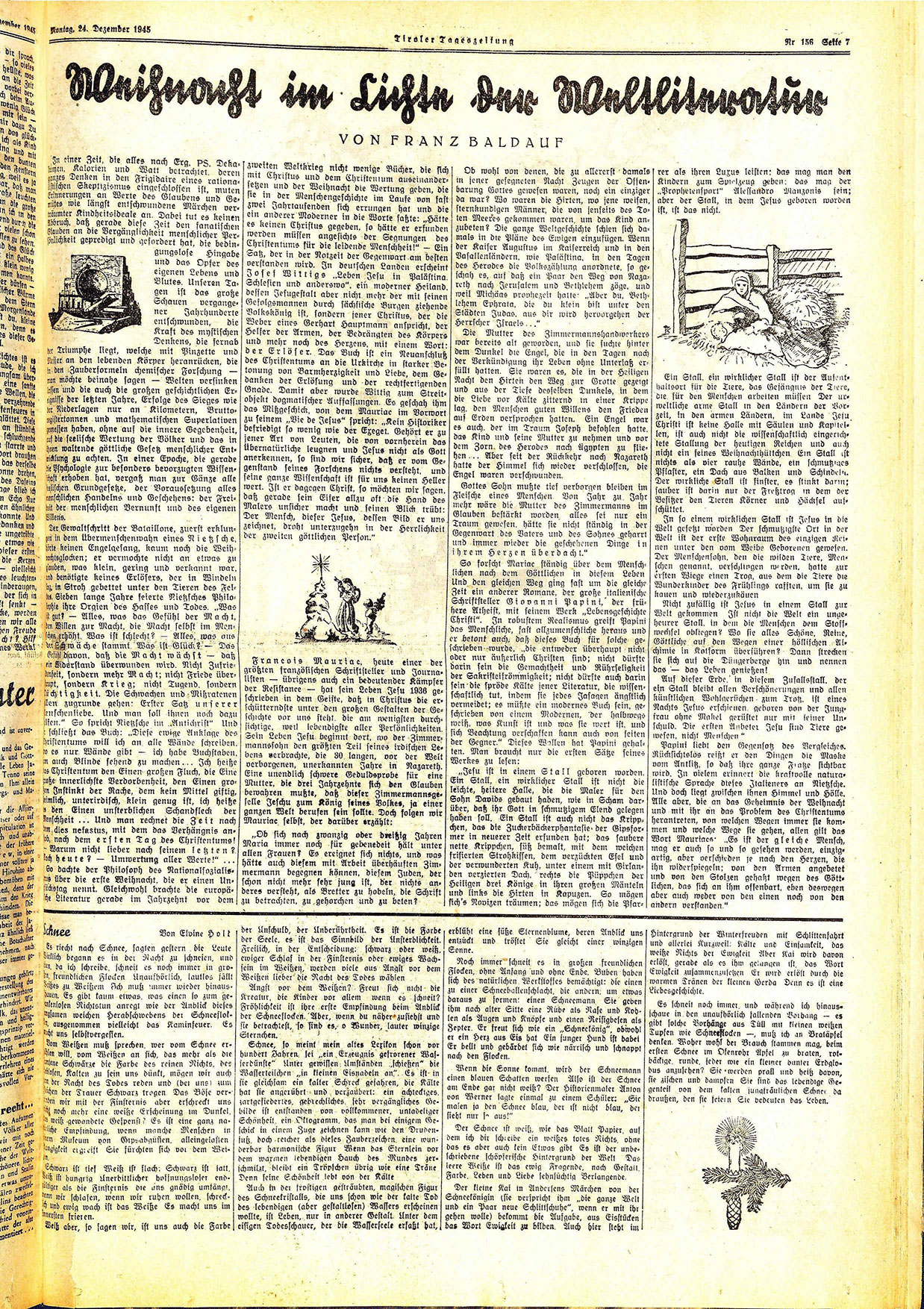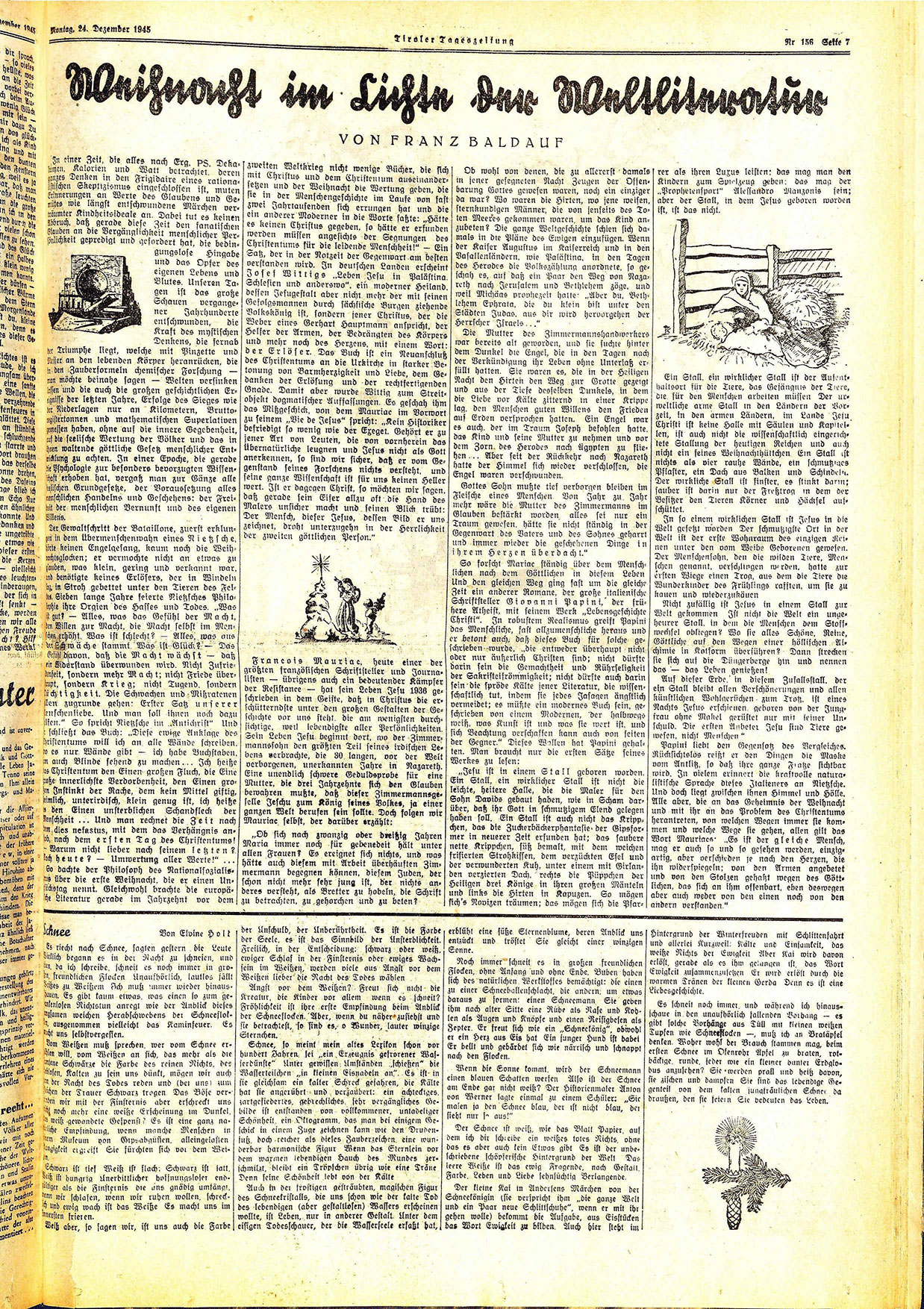Tiroler Tageszeitung 1945
Monat:12
- S.89
Suchen und Blättern in knapp 900 Ausgaben und 25.000 Seiten.
Gesamter Text dieser Seite:
— 1945 Rontag, 24. Dezember 1945
Tiroler Tageszeitung
Nr 156 Seite 7
dr shrec
an die
vordef Jeit
daa 1.20
ich a 16.
ung und 5 den hune
g. weil es so
G1, daß man
raße leuchten
an die große
In ich in der sefurh ven
sen zu sehen.
— ein Halbes
men har9
dürfen — licher Wärme
„dem Sier
t du, kleine en, denn ## s dieser Ge.
richte is u ube, die 6 ungsam übereine sante
2 Wellen, die verzehrende fenfeuers in glättet. Diest an stündlich schluchzende # starrte und Sort draußen das derselbe onne drehen, des Daseins #ge blieb ich n Echo Nur en ähnlichen Ronnte Und danken und 2 ungetrübte — etwas wie Sieser ersten die Kerzen — vielleicht es leuchten inderaugen, der sich in t senkt — ke, werden en wir alle en Freude cht? Hilf nes Werk!
tter
nd ist unver
und das GeIk und Gortle Leben saTenno seine n Ihm allein ags- und Mi
" a an
VONFRANZ BALDAUF
In einer Zeit, die alles nach Erg. PS. Dekahmen, Kalorien und Watt betrachtet, deren Donhon in den Friaidairo pinog ratiana
anzes Lennen in den Frigioaike eines rationalstischen Skeptizismus eingeschlossen ist, muten Erinnerungen an Werte des Glaubens und Genites wie längst entschwundene Märchen vernäumter Kindheitsideale an. Dabei tut es keinen übbruch, daß gerade diese Zeit den fanatischen slauben an die Vergänglichkeit menschlicher Peröulichkeit gepredigt und gefordert hat, die bedingungslose Hingabe und das Opfer des eigenen Lebens und Blutes. Unseren Tagen ist das große Schauen vergangener Jahrhunderte entschwunden, die Kraft des mystischen Denkens, die fernab
ir Triumphe liegt, welche mit Pinzette und fiesser an den lebenden Körper heranrücken, die in den Zauberformeln chemischer Forschung — in möchte beinahe sagen — Welten versinken assen und die auch die großen geschichtlichen Erimisse der letzten Jahre, Erfolge des Sieges wie u Niederlagen nur an Kilometern, Bruttonistertonnen und mathematischen Superlativen znessen haben, ohne auf die innere Gegebenheit, uf die seelische Wertung der Völker und das in zen waltende göttliche Gesetz menschlicher Entriclung zu achten. In einer Epoche, die gerade n Psychologie zur besonders bevorzugten Wissensaft erhoben hat, vergaß man zur Gänze alle slischen Grundgesetze, der Voraussetzung alles unschlichen Handelns und Geschehens: der Freisit der menschlichen
Vernunft und des eigenen Eillens.
Der Gewaltschritt der Bataillone, zuerst erklunin in dem übermenschenwahn eines Nietzsche, sre keinen Engelgesang, kaum noch die Weihuchtsglocken; er vermochte nicht an etwas zu sauben, was klein, gering und verkannt war, und benötigte keines Erlösers, der in Windeln ig in Stroh gebettet unter den Tieren des u Sieben lange Jahre feierte Nietzsches Philoshie ihre Orgien des Hasses und Todes. „Was i gut? — Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? — Alles, was aus äche stammt. Was istGlück? — Das Gesühldavon, daß die Macht wächst — daß in Biderstand überwunden wird. Nicht Zufrieiheit, sondern mehr Macht; nicht Friede übersupt, sondern Krieg; nicht Tugend, sondern sichtigkeit. Die
Schwachen und Mißratenen llen zugrunde gehen: Erster Satz unserer senschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu Afen.“ So spricht Nietzsche im „Antichrist“. Und schließt das Buch: „Diese ewige Anklage des hristentums will ich an alle Wände schreiben. d es nur Wände gibt — ich habe Buchstaben, in auch Blinde sehend zu machen... Ich heiße as Christentum den Einen großen Fluch, die Eine soße innerlichste Verdorbenheit, den Einen groin Instinkt der Rache, dem kein Mittel giftig, timlich, unterirdisch, klein genug ist, ich heiße # den Einen unsterblichen Schandfleck der kenschheit ... Und man rechnet die Zeit nach im dies nefastus, mit dem das Verhängnis anod nach dem ersten Tag des Christentums! Warum nicht lieber nach seinem letzten?
heute? — Umwertung aller Werte!“ ... So dachte der Philosoph des Nationalsozialisus über die erste Weihnacht, die er einen Unsückstag nennt. Gleichwohl brachte die europäche Literatur gerade im Jahrzehnt vor dem
zweiten Weltkrieg nicht wenige Bücher, die sich mit Christus und dem Christenium auseinandersetzen und der Weihnacht die Wertung geben, die sie in der Menschengeschichte im Laufe von fast zwei Jahrtausenden sich errungen hat und die ein anderer Moderner in die Worte faßte: „Hätte es keinen Christus gegeben, so hätte er erfunden werden müssen angesichts der Segnungen des Christentums für die leidende Menschheit!“ — Ein Satz, der in der Notzeit der Gegenwart am besten verstanden wird. In deutschen Landen erscheint Josef Wittigs „Leben Jesu in Palästina. Schlesien und anderswo“, ein moderner Heiland. dessen Jesugestalt aber nicht mehr der mit seinen Gefolgsmannen durch sächsische Burgen ziehende Volkskönig ist, sondern jener Christus, der die
Weber eines Gerhart Hauptmann anspricht, der Helfer der Armen, der Bedrängten des Körpers und mehr noch des Herzens, mit einem Wort: der Erlöser. Das Buch ist ein Neuanschluß des Christentums an die Urkirche in starker Betonung von Barmherzigkeit und Liebe, dem Gedanken der Erlösung und der rechtfertigenden Gnade. Damit aber wurde Wittig zum Streitobjekt dogmatischer Auffassungen. Es geschah ihm das Mißgeschick, von dem Mauriac im Vorwort zu seinem „Vie de Jesus“ spricht: „Kein Historiker befriedigt so wenig wie der Exeget. Gehört er zu jener Art von Leuten, die von vornherein das übernatürliche leugnen und Jesus nicht als Gott anerkennen, so sind wir sicher, daß er vom Gegenstand seines Forschens nichts versteht, und seine ganze
Wissenschaft ist für uns keinen Heller wert. Ist er dagegen Christ, so möchten wir sagen, daß gerade sein Eifer allzu oft die Hand des Malers unsicher macht und seinen Blick trübt: Der Mensch, dieser Jesus, dessen Bild er uns zeichnet, droht unterzugehn in der Herrlichkeit der zweiten göttlichen Person.“
Francois Mauriac, heute einer der größten französischen Schriftsteller und Journalisten — übrigens auch ein bedeutender Kämpfer der Resistance — hat sein Leben Jesu 1936 geschrieben in dem Geiste, daß in Christus die erschütterndste unter den großen Gestalten der Geschichte vor uns steht, die am wenigsten durchsichtige, weil lebendigste aller Persönlichkeiten. Sein Leben Jesu beginnt dort, wo der Zimmermannssohn den größten Teil seines irdischen Lebens verbrachte, die 30 langen, vor der Welt verborgenen, unerkannten Jahre in Nazareth. Eine unendlich schwere Geduldsprobe für eine Mutter, die drei Jahrzehnte sich den Glauben bewahren mußte, daß dieser Zimmermannsgeselle Jeschu zum König seines Volkes, ja einer ganzen Welt berufen sein sollte. Doch
folgen wir Mauriac selbst, der darüber erzählt:
„Ob sich nach zwanzig oder dreißig Jahren Maria immer noch für gebenedeit hält unter allen Frauen? Es ereignet sich nichts, und was hätte auch diesem mit Arbeit überhäuften Zimmermann begegnen können, diesem Juden, der schon nicht mehr sehr jung ist, der nichts anderes versteht, als Bretter zu hobeln, die Schrift zu betrachten, zu gehorchen und zu beten?
Ob wohl von denen, die zu allererst damals in jener gesegneten Nacht Zeugen der Offenbarung Gottes gewesen waren, noch ein einziger da war? Wo waren die Hirten, wo jene weisen, sternkundigen Männer, die von jenseits des Toten Meeres gekommen waren, um das Kind anzubeten? Die ganze Weltgeschichte schien sich damals in die Pläne des Ewigen einzufügen. Wenn der Kaiser Augustus im Kaiserreich und in den Vasallenländern, wie Palästina, in den Tagen des Herodes die Volkszählung anordnete, so geschah es, auf daß ein Paar den Weg von Nazareth nach Jerusalem und Bethlehem zöge, und weil Michäas provhezeit hatte: „Aber du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten Judas, aus dir wird hervorgehen der Herrscher Isracls.“
Die Mutter des Zimmermannshandwerkers war bereits alt geworden, und sie suchte hinter dem Dunkel die Engel, die in den Tagen nach der Verkündigung ihr Leben ohne Unterlaß erfüllt hatten. Sie waren es, die in der Heiligen Nacht den Hirten den Weg zur Grotte gezeigt und aus der Tiefe desselben Dunkels, in dem die Liebe vor Kälte zitternd in einer Krippe lag, den Menschen guten Willens den Frieden auf Erden versprochen hatten. Ein Engel war es auch. der im Traum Joseph befohlen hatte. das Kind und seine Mutter zu nehmen und vor dem Zorn des Herodes nach Agypten zu fliehen... Aber seit der Rückkehr nach Nazareth hatte der Himmel sich wieder verschlossen, die Engel waren verschwunden.
Gottes Sohn mußte tief verborgen bleiben im Fleische eines Menschen. Von Jahr zu. Jahr mehr wäre die Mutter des Zimmermanns im Glauben bestärkt worden alles sei nur ein Traum gewesen, hätte sie nicht ständig in der Gegenwart des Vaters und des Sohnes geharrt und immer wieder die geschehenen Dinge in ihrem Herzen überdacht.“
So forscht Mariae ständig über dem Menschlichen nach dem Göttlichen in diesem Leben Und den gleichen Weg ging fast um die gleiche Zeit ein anderer Romane, der große italienische Schriftsteller Giovanni Papini, der frühere Atheist, mit seinem Werk „Lebensgeschichte Christi“. In robustem Realismus greift Papini das Menschliche, fast allzumenschliche heraus und er betont auch, daß dieses Buch für solche geschrieben wurde, „die entweder überhaupt nicht oder nur äußerlich Christen sind; nicht dürfte darin sein die Gemachtheit und Rührseligkeit der Sakristeifrömmigkeit; nicht dürfte auch darin sein die spröde Kälte jener Literatur, die wissenschaftlich tut, indem sie jedes Jasagen ängstlich vermeidet; es müßte ein modernes Buch sein, geschrieben von einem Modernen,
der halbwegs weiß, was Kunst ist und was sie wert ist. und sich Beachtung verschaffen kann auch von seiten der Gegner.“ Dieses Wollen hat Papini gehalten. Man braucht nur die ersten Sätze seines Werkes zu lesen:
„Jesu ist in einem Stall geboren worden. Ein Stall, ein wirklicher Stall ist nicht die leichte, heitere Halle, die die Maler für den Sohn Davids gebaut haben, wie in Scham darüber, daß ihr Gott in schmutzigem Elend gelegen haben soll. Ein Stall ist auch nicht das Krippchen, das die Zuckerbäckerphantasie der Gipsformer in neuerer Zeit erfunden hat; das saubere nette Krippchen, süß bemalt, mit dem weichen frisierten Strohkissen, dem verzückten Esel und der verwunderten Kuh, unter einem mit Girlanden verzierten Dach, rechts die Püppchen der Heiligen drei Könige in ihren großen Mänteln und links die Hirten in Kapuzen. So mögen sich"s Novizen träumen; das mögen sich die Pfar
rer als ihren Luxus leisten: das mag man den Kindern zum Spiolzeug geben: das mag der „Prophetensport“ Alessandro Manzonis sein; aber der Stall, in dem Jesus geboren worden ist, ist das nicht.
Ein Stall, ein wirklicher Stall ist der Aufenthaltsort für die Tiere, das Gefängnis der Tiere, die für den Menschen arbeiten müssen Der urweltliche arme Stall in den Ländern der Vorzeit, in den armen Ländern, im Lande Jesu. Christi ist keine Halle mit Säulen und Kapitellen, ist auch nicht die wissenschaftlich eingerichtete Stallung der heutigen Reichen und auch nicht ein feines Weihnachthüttchen Ein Stall ist nichts als vier rauhe Wände, ein schmutziges Pflaster, ein Dach aus Balken und Schindeln. Der wirkliche Stall ist finster, es stinkt darin; sauber ist darin nur der Freßtrog in dem der Besitzer den Tieren Körner und Häcksel aufschüttet.
In so einem wirklichen Stall ist Jesus in die Welt gesetzt worden Der schmutzigste Ort in der Welt ist der erste Wohnraum des einzigen Reinen unter den vom Weibe Geborenen gewesen. Der Menschensohn, den die wilden Tiere, Menschen genannt, verschlingen werden, hatte zur ersten Wiege einen Trog, aus dem die Tiere die Wunderkinder des Frühlings rafften, um sie zu kauen und wiederzukäuen
Nicht zufällig ist Jesus in einem Stall zur Welt gekommen Ist nicht die Welt ein ungeheurer Stall, in dem die Menschen dem Stoffwechsel obliegen? Wo sie alles Schöne, Reine, Göttliche auf den Wegen einer höllischen Alchimie in Kotform überführen? Dann strecken sie sich auf die Düngerberge hin und nennen das — das Leben genießen!
Auf dieser Erde, in diesem Zufallsstall. der ein Stall bleibt allen Verschönerungen und allen künstlichen Wohlgerüchen zum Trotz, ist eines Nachts Jesus erschienen, geboren von der Jungfrau ohne Makel gerüstet nur mit seiner Unschuld. Die ersten Anbeter Jesu sind Tiere gewesen, nicht Menschen“
Papini lieht den Gegensotz des Vergleiches. Rücksichtslos reißt er den Dingen die Maske vom Antlitz, so daß ihre ganze Fratze sichtbar wird. In vielem erinnert die kraftvolle naturalistische Sprache dieses Italieners an Nietzsche. Und doch liegt zwischen ihnen Himmel und Hölle. Alle aber, die an das Geheimnis der Weihnacht und mit ihr an das Problem des Christentums herantreten, von welchen Wegen immer sie kommen und welche Wege sie gehen, allen gilt das Wort Mauriaes: „Es ist der gleiche Mensch, mag er auch so und so gesehen werden, einzigartig, aber verschieden je nach den Herzen, die ihn widerspiegeln; von den Armen angebetet und von den Stolzen gehaßt wegen des Göttlichen, das sich an ihm offenbart, eben deswegen aber auch weder von den einen
noch von den andern verstanden.“
sch
inee
Von Elvine Holt
recht
N Mg che de“ sicht
Es riecht nach Schnee, sagten gestern die Leute süllich begann es in der Nacht zu schneien, und kn, da ich schreibe, schneit es noch immer in gro# freundlichen Flocken Anaufhörlich, lautlos fällt sißes zu Weißem Ich muß immer wieder hinauszuen. Es gibt kaum etwas, was einen so zum geAlenlosen Richtstun anregt wie der Anblick dieses agsamen weichen Herabschwebens der SchneeflokA. ausgenommen vielleicht das Kaminfeuer. Es sicht uns selbstvergessen.
Vom Weißen muß sprechen, wer vom Schnee erAlen will, vom Weißen an sich, das mehr als die miene Schwärze die Farbe des reinen Nichts, des Mlosen, Kalten zu sein uns dünkt, mögen wir auch in der Nacht des Todes reden und (bei uns zum sichen der Trauer Schwarz trogen Das Böse ver#den wir mit der Finsternis aber erschreckt uns 2 noch mehr eine weiße Erscheinung im Dunkel. weiß gewandete Gespenst? Es ist eine ganz naWliche Empfindung, wenn manche Menschen in Am Museum von Gipsabgüssen, alleingelassen sungigkeit ergreift Sie fürchten sich vol dem Wei
e Gereher
Shied
der 4
Schwarz ist tief Weiß ist flach: Schwarz ist satt. seiß ist bungrig Unerbittlicher hoffnungsloser endültiger als die Finsternis die uns gnädig umfängt. semn wir schlafen, wenn wir ruhen wollen, schreckund ewig wach ist das Weiße Es macht uns im inersten frieren.
aber, so sagen wir, ist uns auch die Farbe
der Anschuld, der Anberührtheit. Es ist die Forbe der Seele, es ist das Sinnbild der Ansterblichkeit. Freilich, in der Entscheidung: schwarz oder weiß, ewiger Schlaf in der Finsternis oder ewiges Wachsein im Weißen, werden viele aus Angst vor dem Weißen lieber die Nacht des Todes wählen
Angst vor dem Weißen? Freut sich nicht die Kreatur, die Kinder vor allem wenn es schneit? Fröhlichkeit ist ihre erste Empfindung beim Anblick der Schneeflocken. Aber, wenn du näher zusiehst und sie betrachtest, so sind es, o Wunder, lauter winzige Sternchen.
Schnee, so meint mein altes Lexikon schon vor hundert Jahren sei „ein Erzeugnis gefrorener Wasserdünste“ Anter gewissen Amständen „schießen“ die Wasserteilchen „in kleinen Eisnadeln an“. Es ist in sie gleichsam ein kalter Schreck gefahren, die Kälte hat sie angerührt und verzaubert: ein achteckiges. zartgefiedertes, gebrechliches, sehr vergängliches Gebilde ist entstanden von vollkommener, untadeliger Schönheit, ein Oktogramm, das man bei einigem Geschick in einem Zuge zeichnen kann wie den Drudenfuß, doch reicher als dieses Zauberzeichen, eine wunderbar harmonische Figur Wenn das Sternlein vor dem warmen lebendigen Hauch des Mundes zerschmilzt, bleibt ein Tröpfchen übrig wie eine Träne Denn seine Schönheit lebt von der Kälte
Auch in dei frostigen gesträubten, magischen Figur des Schneekristalls, die uns schon wie der kalte Tod des lebendigen (aber gestaltlosen) Wassers erscheinen wollte, ist Leben, nur in anderer Gestalt. Unter dem eisigen Todesschauer, der die Wasserseele erfaßt hat,
erblüht eine süße Sternenblume, deren Anblick uns entzückt und tröstet Sie gleicht einer winzigen Sonne.
Noch immer schneit es in großen freundlichen Flocken, ohne Anfang und ohne Ende. Buben haben sich des natürlichen Werksloffes bemächtigt: die einen zu einer Schneeballenschlacht, die andern, um etwas daraus zu formen: einen Schneemann Sie geben ihm nach alter Sitte eine Rübe als Nase und Kohlen als Augen und Knopfe und einen Reisigbesen als Zepter. Er freut sich wie ein „Schneckönig“, obwohl er ein Herz aus Eis hat Ein junger Hund ist dabei Er bellt und gebärdet sich wie närrisch und schnappt nach den Flocken.
Wenn die Sonne kommt, wird der Schneemann einen blauen Schatten werfen Also ist der Schnee am Ende gar nicht weiß? Der Historienmaler Anion von Werner sagte einmal zu einem Schüler: „Sie malen ja den Schnee blau, der ist nicht blau, der sieht nur so aus!“
Der Schnce ist weiß, wie das Blatt Papier, auf dem ich dir schreibe ein weißes totes Nichts, ohne das es aber auch kein Etwas gibt Es ist der unbeschriebene schöpferische Hintergrund der Welt Das leere Weiße ist das ewig Fragende, nach Gestall. Farbe. Leben und Liebe sehnsüchtig Verlangende.
Der kleine Kai in Andersens Märchen von der Schneekönigin (sie verspricht ihm „die ganze Welt und ein Paar neue Schlittschuhe“, wenn er mit ihr gehen wolle) bekommt die Aufgabe, aus Eisstücken das Wort Ewigkeit zu bilden. Auch hier steht im
Hintergrund der Winterfreuden mit Schlittenfahrt und allerlei Kurzweil: Kälte und Einsamkeit, das weiße Nichts der Ewigkeit Aber Kai wird davon erlöst, gerade als es ihm getungen ist, das Wort Ewigkeit zusammenzusetzen Er wird erlöst durch die warmen Tränen der kleinen Gerda Denn es ist eine Liebesgeschichte.
Es schneit noch immer, und während ich hinausschaue in den unaufhörlich fallenden Vorhang — es gibt solche Vorhänge aus Tüll mu kleinen weißen Tupfen wie Schneeflocken —, muß ich an Bratäpfel denken. Woher wohl der Brauch stammen mag, beim ersten Schnee im Ofenrohr Apfel zu braten, rotbäckige, runde, jeder wie ein kleiner bunter Erdglobus anzusehen? Sie werden prall und heiß davon, sie zischen und dampfen Sie sind das lebendige Gegenteil von dem kalten jungfräulichen Schnei da draußen, den sie feiern Sie bedeuten das Leben.